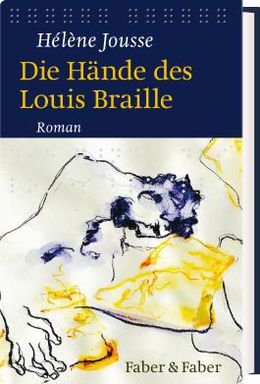
Dieser Roman hat eine ganz ungewöhnliche Methode, eine Biographie zu präsentieren. Eine Biographie über einen Menschen, über den zumindest ich bislang nicht viel wusste.
Die Autorin erzählt in ihrem Debütroman das Leben des Erfinders der Blindenschrift in Form einer verschachtelten Geschichte. Die relativ frisch verwitwete Constance bekommt von ihrem Verleger den Auftrag, das Drehbuch zu einem Film über Louis Braille zu schreiben. Zuerst eher zurückhaltend, dann immer intensiver beschäftigt sie sich mit diesem Thema, recherchiert und fühlt sich tief in die Person ein, über die sie schreiben will. Dabei hält sie ihre Gedanken und Gefühle in einem Roten Heft fest. In diesem lesen wir über den Fortgang ihrer Arbeit an dem Drehbuch und ihre Entwicklung im gleichen Maße, wie sich ihr Buch entwickelt.
Parallel folgen wir Szene für Szene durch das Drehbuch dem Leben des kleinen Louis, der im Alter von drei Jahren durch einen Unfall sein Augenlicht verliert. Louis, der der Nachzügler in der Familie Braille war, wächst in äußerst liebevollen Familienverhältnissen auf, von seiner Mutter Monique, seinem Vater Simon, einem Sattler, und den drei älteren Schwestern verwöhnt und behütet. Als sich immer mehr erweist, dass weder Lehrer noch Pfarrer oder seine Eltern ihm neues beibringen können, bringt sein Vater ihn schweren Herzens in Paris im Königlichen Institut für junge Blinde unter.
Hier geht es hart und streng zu, Anfang des 19. Jahrhunderts hat man wenig Geduld und Verständnis für jedwede Behinderung. Es dauert lange, bis sich Louis im Institut einlebt, vor allem aufgrund der großen Enttäuschung, die er bei seiner Ankunft erlebte. Hatte er doch erwartet, ja gehofft, dort Bücher vorzufinden, die für Blinde lesbar wären. Doch die einzigen Bücher, die die Kinder lesen können, sind ganze 20 Folianten, die in Reliefschrift geschrieben sind.
Hélène Jousse schildert den jungen Louis Braille als ungewöhnlich klug und lernfähig, er wird der beste Schüler der Klasse, ja der ganzen Schule. Doch er ist immer unzufrieden, verlangt nach mehr, verlangt danach, selbst Bücher lesen zu können. „Louis will etwas Besseres, etwas viel Besseres und, unverhohlen gesagt, etwas Gleichwertiges … Jawohl, etwas den Sehenden, den Lesenden Gleichwertiges. Alles soll gleich sein in ihrem blinden Kopf, voller Wörter, Wortbilder, Wortgedanken. Man kann nichts ohne Wörter. Man kann nichts, wenn man Wörter nicht lesen kann.“ (S. 149).
Als er durch einen Hauptmann von einer in Papier getriebene Punktschrift erfährt, die jedoch eher eine Lautschrift ist, ist das für Louis wie eine Erleuchtung. Aber es wird noch einige lange Jahre und viele Versuche dauern, bis er schließlich die, erst lange nach seinem Tod nach ihm benannte, Braille-Schrift entwickelt.
Der Roman konzentriert sich auf die sehr frühe Jugend des Louis Braille, etwas, was mir ein Manko erscheint, denn mich hätte auch seine weitere Entwicklung interessiert. Doch das Buch endet kurz nach seiner Erfindung, als er gerade einmal 16 Jahre alt ist. Dennoch liest sich der Roman wunderbar, flüssig und spannend. Die Autorin schreibt mit viel Gefühl ohne pathetisch oder rührselig zu werden, auch wenn die heile Welt in der Familie Braille für die damalige Zeit vielleicht ein klein wenig übertrieben scheint. Die Gegenüberstellung mit der heutigen Welt, mit dem Leben der Drehbuchautorin Constance, die eine manchmal fast zu innige Beziehung zu ihrem eigenen Protagonisten aufzubauen scheint, macht das Buch in zweifachem Sinne spannend. Und ganz nebenbei lernt man auch noch etwas über die Lebensverhältnisse blinder Kinder in den Anfangsjahren des 19. Jahrhunderts. Alles in allem ein wirklich empfehlenswertes Buch. Nur die ein wenig zu oft vorkommenden Druckfehler schmälern den Lesegenuss dann noch etwas. Dafür ist die äußere Aufmachung des Buches, die den Titel zusätzlich in Brailleschrift aufführt, wie ich finde sehr gut gelungen.
Hélène Jousse – Die Hände des Louis Braille
Faber & Faber, September 2020
Gebundene Ausgabe, 249 Seiten, 24,00 €
